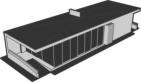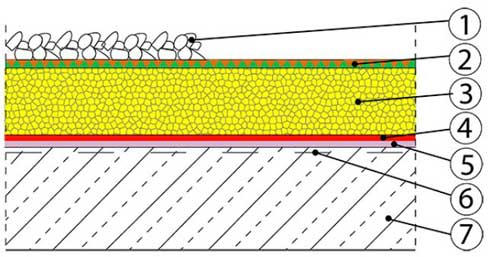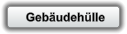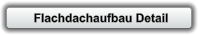Das Umkehrdach
1. Auflast/Oberflächenschutz
2. Filterflies
3. Wärmedämmung (Extr. PS-
Hartschaum)
4. Oberlage der Abdichtung
(Polymerbitumenbahn)
5. Erste Lage der Abdichtung
6. Bitumen-Voranstrich
7. Unterkonstruktion aus
Beton
Zunächst wird beim
Umkehrdach so vorgegangen,
wie beim Warmdach. Für das
notwendige Gefälle bei Stahlbetonkonstruktionen sorgt wieder der Gefällebeton, es folgen
Voranstrich und Ausgleichsschicht. Nun kommt aber nicht, wie beim Warmdach, die
Wärmedämmung, sondern die Dachabdichtung. Die Abdichtung bei Umkehrdächern wird
vorzugsweise mit zwei Lagen Polymerbitumenbahnen ausgeführt. Erst danach kommt die
Wärmedämmung. Da diese komplett der Witterung ausgesetzt ist, kann natürlich nicht jeder
Dämmstoff verwendet werden. Mineralwolle beispielsweise würde sich mit Wasser vollsaugen und
wäre unbrauchbar. Extrudiertes Polystyrol ist wasserfest und eignet sich auch als Umkehrdämmung.
Bei fachgerechter Ausführung bietet ein Umkehrdach einige Vorteile gegenüber dem herkömmlichen
Warmdach. Dies beginnt bereits in der Bauphase. Dadurch, dass die Dachabdichtung als erstes
erfolgt, ist man in den weiteren Bauphasen nicht mehr abhängig von der Witterung. Die Verlegung
der Dämmplatten und z.B. der Kiesschicht (beachten Sie dazu den Abschnitt "Kies auf dem Dach - ja
oder nein?) kann auch bei schlechtem Wetter erfolgen. Sind die Dämmplatten verlegt, kann sich die
Dachabdichtung durch die Sonne nicht mehr aufheizen. Auch Blasenbildung in der Abdichtung durch
eingeschlossene Feuchtigkeit wird weitestgehend vermieden. Durch die Dämmschicht ist die
Abdichtung zudem vor mechanischen Einwirkungen geschützt. So ist es bei Gründächern zum
Beispiel nicht mehr notwendig, eine teure zusätzliche Schutzschicht einzubauen. Die
Wärmedämmung übernimmt diese Funktion. Auch eine Dampfsperre ist bei einem Umkehrdach nicht
notwendig. Da die Dämmstoffplatten in der Regel lose verlegt werden, ist zudem ein einfacher
Rückbau möglich. Die Platten können dann anschließend sogar wiederverwendet werden.