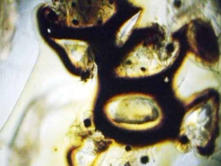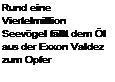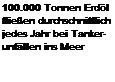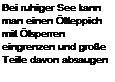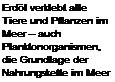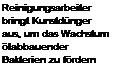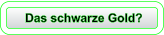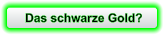Die Ölpest
Erdöl ist nicht nur ein wertvoller Rohstoff – es ist auch ein Cocktail
von Gefahrenstoffen. Gesundheitsgefährdende, teils sogar Krebs er-
regende Verbindungen aus Kohlenstoff und Wasserstoff sind darin
enthalten: zum Beispiel so genannte "polyzyklische
Aromaten" oder Substanzen wie Benzol oder
Naphtalin. Etwa 1,3 Millionen Tonnen
Erdölkohlenwasserstoffe landen jedes Jahr im Meer
das meiste durch chronische, schleichende
Verschmutzung wie Eintrag durch die Flüsse oder
ganz normaler Schiffsbetrieb. Nur 8 %, durchschnittlich 100.000 Tonnen, laufen jährlich bei
Tankerunfällen aus. Doch die Folgen für die Meeresumwelt sind bei so einem Unfall katastrophal.
Der Fall Exxon Valdez
Die Havarie der Exxon Valdez vor der Küste Alaskas am 24. März 1989 – der
größte Öltanker-Unfall in der Geschichte der USA – brennt sich besonders ins
Gedächtnis der Öffentlichkeit: Ein vorher fast unberührtes, extrem empfindliches
Naturgebiet wird mit 40.000 Tonnen Rohöl verseucht. Rund
250.000 Seevögel sterben, 2.800 Seeotter und mehrere hundert
Robben – und das sind nur die augenfälligsten Opfer. Das ge-
samte Ökosystem ist auf Jahre ruiniert: Die Bedingungen für die
natürliche Selbstreinigung des Meeres und der Küste sind dort
schwierig. Zudem verschlimmern gravierende Fehler bei der
Ölbekämpfung die Folgen des Unfalls.
1. Fehler direkt nach dem Unfall: Untätigkeit
Die See ist ruhig, als das Öl ausläuft und bleibt es auch noch drei
Tage lang – optimale Bedingungen für die Ölbekämpfung auf See.
Der Ölteppich ist zu diesem Zeitpunkt vergleichsweise klein, nur 7 km
lang. Ölbekämpfungsschiffe könnten ihn mit Ölsperren eindämmen
und dann absaugen – Maßnahmen, die bis
Windstärke 6 gut funktionieren. Aber vor Ort ist man
auf so einen Unfall nicht vorbereitet: Weder die nö-
tige Ausrüstung, noch genügend Personal gibt es
dort. In dieser Phase könnte man den Tanker auch
noch gut leer pumpen und abschleppen und damit
das Schlimmste verhindern. Aber beim verantwortlichen Ölkonzern Exxon will niemand die Kosten für
diese Aktion absegnen – die Entscheidung wird vom einem zum anderen weitergereicht. Die einzige,
die in dieser Zeit Öl aus dem Meer entfernt, ist die Natur selbst: Rund 25 % des auslaufenden Öls, die
leicht flüchtigen Bestandteile, verdunsten. Nicht so viel wie bei anderen Unfällen, dort können es je
nach Ölsorte und Temperatur bis zu 60 % sein.
Der Sturm
Nach drei Tagen schlägt das Wetter um und die Chance das Öl auf
See zu bergen ist vertan. In manchen Fällen kann ein Sturm dem
Meer bei der Selbstreinigung helfen. Wind und Wellen zerschlagen
das Öl in feinste Tröpfchen und verteilen es in der Wassersäule. Ist
die Strömung stark genug, wird es dann ins offene
Meer getragen und entsprechend verdünnt. In die-
sem Zustand können Bakterien das Öl auch leichter
abbauen. Aber die Exxon Valdez liegt zu nah vor der
Küste und der Wind weht zum Land hin. Der
Ölteppich dehnt sich rasch auf eine Länge von 700
km aus und legt sich über Tiere und Pflanzen.
2. Fehler bei der Ölbekämpfung an Land: falsche Methoden
Alle Versuche, das Öl von der Küste fernzuhalten, schlagen fehl. Im Sturm unterwandert es die
Ölsperren, die nun doch ausgebacht worden sind. Chemikalien, die den Ölteppich auflösen sollen –
sogenannte Dispergatoren – können wegen des schlechten Wetters nicht ausgebracht werden. Ein
großer Teil des Erdöls strandet schließlich und verseucht die Küste Alaskas auf einer Länge von über
2.000 km. Exxon übernimmt die Federführung bei den Reinigungsarbeiten und hat dabei vor allem ein
Ziel: das Öl möglichst schnell unsichtbar zu machen. Mit Hochdruckreinigern spritzen sie das Öl mit
heißem Wasser von den verschmutzten Felsen wieder ins Wasser zurück. Dadurch wird das Öl aber
nicht entfernt, sondern nur verschoben. Die nächste Flut spült es wieder an Land.Zusätzlich treiben
die Hochdruckreiniger das Öl tief in den Boden. Dort liegt es unter Licht- und Luftabschluss und kann
nur sehr langsam biologisch abgebaut werden. Zudem tötet das heiße Wasser an den Stränden auch
die wenigen Pflanzen und Tiere ab, die das Öl überlebt haben. Die Wiederbesiedlung "behandelter"
Strände geht deshalb sehr langsam voran und die Artenzusammensetzung ist verändert.
3. Fehler: Sinnvolle Maßnahmen werden falsch durchgeführt
Die einzigen, die das Öl an der Küste wirklich verschwinden lassen
können, sind Öl abbauende Bakterien. Sie zählen zur natürlichen
Bakterienflora, aber ihre Dichte ist in unbelasteten Gebieten gering.
Um das Wachstum dieser Bakterien anzukurbeln, bringen die
Reinigungstrupps Dünger aus. Eigentlich ist das
eine sinnvolle Maßnahme, die vor allem in empfind-
lichen Ökosystemen die Selbstreinigung der Küste
schonend unterstützen kann. Aber die Düngung
muss an die Bedürfnisse der "Ölfresser" angepasst
werden. Denn die Zusammensetzung dieser
Bakterienflora ändert sich im Laufe des Abbauprozesses und dementsprechend auch ihr
Nährstoffbedarf. Außerdem brauchen die Öl abbauenden Bakterien unbedingt Sauerstoff, und der ist
tiefer im Boden rasch aufgebraucht, wenn nicht zusätzlich belüftet wird. All dies wird bei den
Düngeaktionen in Alaska nicht berücksichtigt und deshalb bleiben sie ohne Erfolg.
Folgen und Lehren
Als Konsequenz aus der Katastrophe sind an der Südküste Alaskas jetzt Einsatzzentralen der
Küstenwache für die Ölbekämpfung rund um die Uhr in Bereitschaft. In regelmäßigen Abständen gibt
es Übungen für den Ernstfall. Auch die Sicherheitsbestimmungen für die Durchfahrt von Tankern
durch die Soundgebiete wurden drastisch verschärft. Nach dem Unfall der Exxon Valdez wurden die
Bemühungen um Tankersicherheit, Ölbekämpfungsmaßnahmen und die Forschung über ökologische
Folgen von Ölkatastrophen weltweit intensiviert. Die beste Bekämpfung von Ölunfällen ist und bleibt
aber ihre Vermeidung. Doch das Risiko bleibt, solange Erdöl in Tankern über die Weltmeere transpor-
tiert wird.