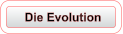Die Evolution in einem Stück
Die Geschichte am Stück
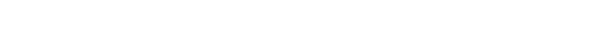
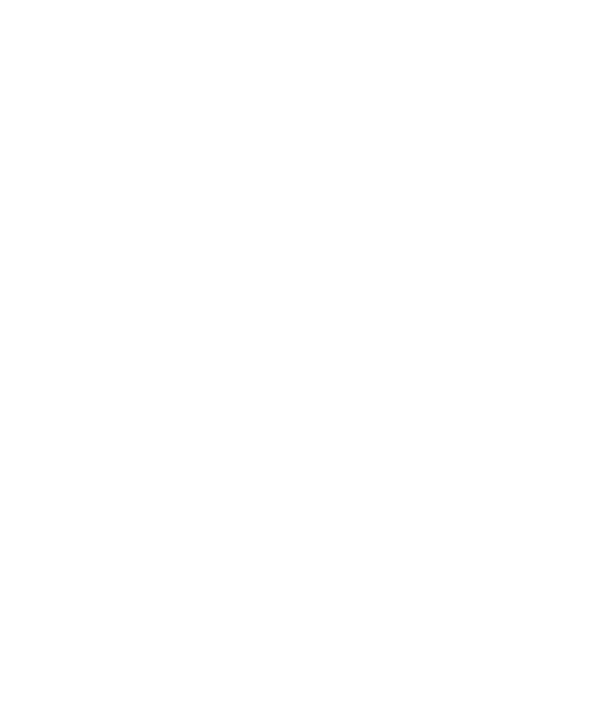
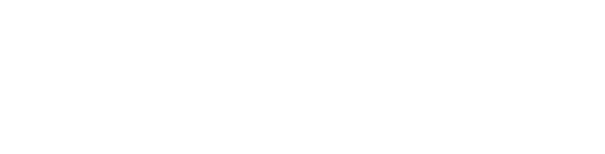
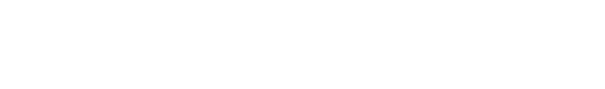
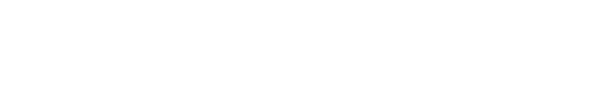
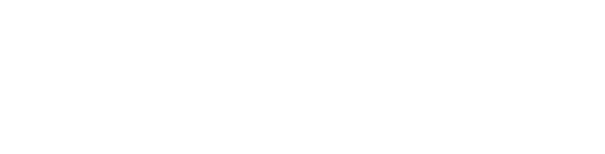
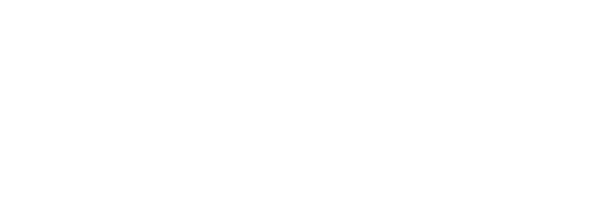
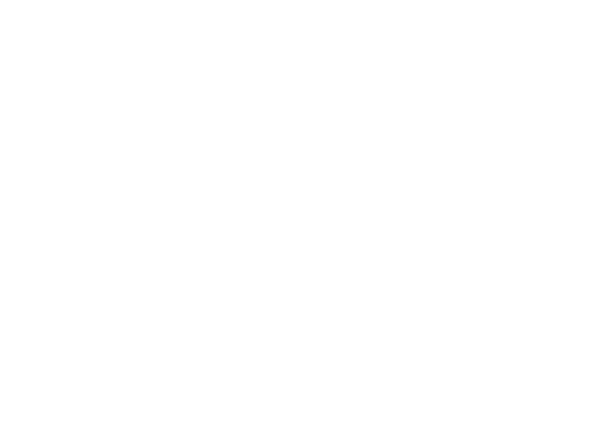
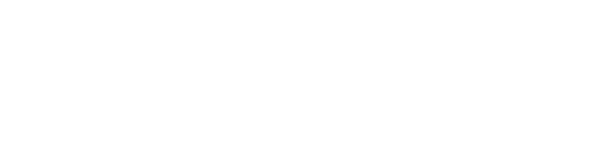
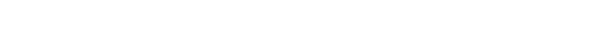
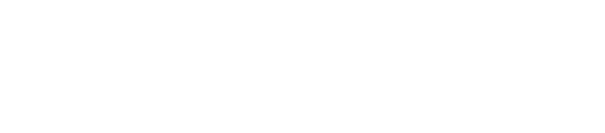
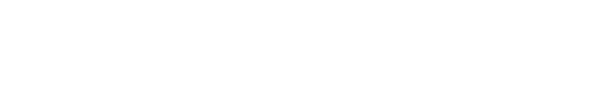
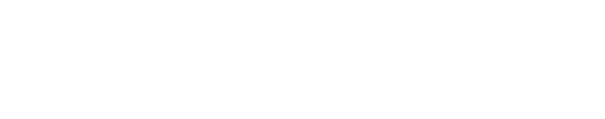
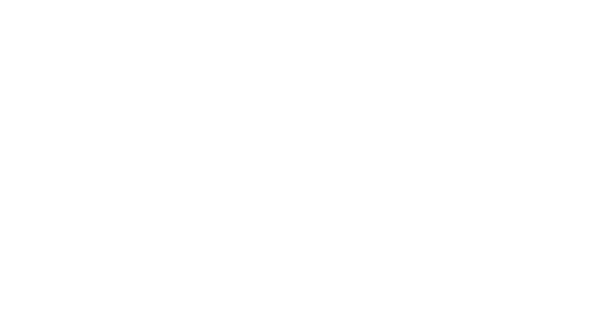
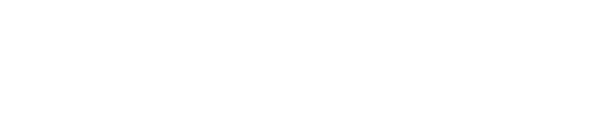
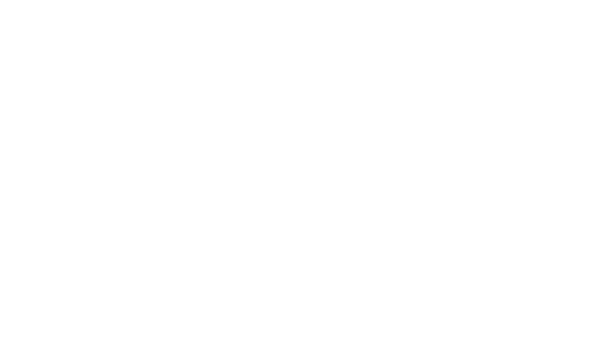
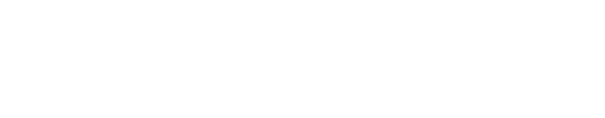
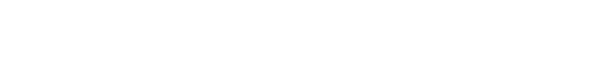



Auszug aus einem Vortrag "Erde und Weltraum - ein Streifzug durch Raum und Zeit" von Alvo v. Alvensleben
aus Freiburg i. Br. (1970) mit Ergänzungen von W. Beyer (kursiv). Bei Gelegenheit werde ich die Daten noch
von 5 auf 4,5 Milliarden Jahre umrechnen.
Um was geht es?
Nicht nur kosmische Entfernungen, auch kosmische Zeiten sind so groß, dass unsere
Anschauung, die an Metern und Minuten geschult ist, uns völlig im Stich lässt. So ist es für
unser Vorstellungsvermögen ziemlich gleichgültig, ob ich sage, die Erde als eine die Sonne
umkreisende Kugel sei etwa 5 Millionen - oder sie sei 5 Milliarden Jahre alt. Beide Zeiträume
liegen so weit jenseits unserer uns vertrauten Vorstellungswelt, dass wir sie nicht wirklich
unterscheiden können.
Um dennoch eine Vorstellung wenigstens der relativen zeitlichen Ordnung und Größe
geologischer Epochen zu bekommen, wollen wir (nach einem Vorschlag von Prof. Heinrich
Siedentopf) das Alter der Erde - rund 5 Milliarden Jahre - auf den Zeitraum eines Jahres
abbilden. Den uns geläufigen Unterteilungen der Zeit entsprechen dann (abgerundet) folgende
Zeiträume:
1 Monat
=
420 Millionen Jahre
1 Woche
=
100 Millionen Jahre
1 Tag
=
14 Millionen Jahre
1 Stunde
=
600 000 Jahre
1 Minute
=
10 000 Jahre
1 Sekunde
=
160 Jahre
In diesem Maßstab dauert ein Menschenleben von 80 Jahren also rund eine halbe "Sekunde".
Januar
Lassen wir nun die Erdentstehung am 1. Januar beginnen, und den heutigen Tag mit der
Mitternacht des 31. Dezember unseres Modelljahres zusammenfallen.
Am Neujahrstag existiert die Sonne bereits, und in ihrer Umgebung haben sich einzelne
Klumpen aus Gesteinsbrocken, Staub und Gas zusammengeballt - die Planeten im Urzustand.
Im Lauf des Januar erhitzt sich die Erde, teils durch die beim Aufschlagen von Materie als
Wärme freiwerdende kinetische Energie, teils durch den Zerfall radioaktiver Elemente. Die
Erdkugel wird soweit flüssig, dass der größte Teil des in der Ursubstanz vorhandenen Eisens
in den Erdkern absinkt.
Februar
Am 1. Februar hat die Erde einen schweren Eisenkern, um den herum ein Mantel von
leichteren Silikaten liegt, darüber eine Gashülle, die überwiegend aus Wasserstoff besteht.
Der Mond, bei dessen Entstehung es weniger heiß hergegangen ist, hat bereits eine -
mindestens teilweise - feste Kruste.
April
Im Laufe des Februar und März kühlt sich die Erde weiter ab; aber erst im April entstehen die
ersten festen Schollen an der Oberfläche des noch glutflüssigen Erdmantels. Die
Erdatmosphäre hat ihren Wasserstoff teilweise in den Weltraum verloren und besteht
wahrscheinlich aus Methan, Ammoniak, Kohlendioxid und Wasserdampf. Freien Sauerstoff
gibt es noch nicht.
Mai
Anfang Mai ist die Erdoberfläche soweit abgekühlt, dass Wasser nicht mehr verdampft; nun
können sich Ozeane, Flüsse und Seen bilden. Das Wasser beginnt sogleich zusammen mit
dem Wind, Erhebungen der Erdkruste abzutragen.
Mitte Mai entstehen die allerersten Lebensspuren im Meer - einzellige Blaualgen und
Bakterien.
Beim Stoffwechsel der Algen wird Sauerstoff freigesetzt - ganz langsam beginnt eine
Umwandlung der Atmosphäre, die für die weitere Entwicklung des Lebens von
entscheidender Bedeutung ist.
August
Aber erst Ende August gibt es genügend Sauerstoff für die einfachsten Tiere. Aus dieser Zeit
stammen die Überreste von kleinen zweischaligen Krebsen.
Während die Entwicklung des Lebens nur langsam voranschreitet, sind die Kräfte, die die
Erdoberfläche gestalten, umso aktiver. Erdschollen brechen auf, schieben sich übereinander,
Gebirge entstehen und werden von Wind und Wasser wieder eingeebnet. Im Oktober wird bei
gewaltigen Lavaergüssen der ganze Nordosten Kanadas, eine Fläche von 5 Millionen
Quadratkilometer, 5 Kilometer hoch mit einer Lavaschicht überzogen.
Etwa um dieselbe Zeit, vielleicht durch die Trübung der Erdatmosphäre ausgelöst, die mit
dem kanadischen Lavaausbruch verbunden gewesen sein muss, beginnt eine erste Eiszeit,
deren Spuren sich noch heute in Kanada finden lassen (Huronische Vereisung); sie dauert
einen oder zwei Tage unseres Modelljahres.
November
Am 19. November beginnt ein neuer Abschnitt der Erdgeschichte, das Kambrium. Von nun
an werden die erhalten gebliebenen Spuren zahlreicher.
Aus ihnen erfahren wir, dass sich die Erde in knapp 21 Stunden um ihre Achse dreht; das Jahr
hat 425 dieser kurzen Tage. Der Mond steht der Erde etwas näher als heute und umkreist sie
jährlich 13 mal. Am 20. oder 21. November beginnt eine zweite große Vereisung; ihre Spuren
lassen sich heute noch in Europa, Afrika und Australien nachweisen (Eokambrische
Vereisung).
Der 22. November ist ein besonderer Tag. Innerhalb weniger Stunden entstehen die Baupläne
sämtlicher Lebewesen. Bis Silvester wird nichts wesentlich Neues hinzukommen. Die Ursache
dieser sog. "Kambrischen Explosion" war vermutlich ein deutlicher Anstieg des
Sauerstoffgehaltes der Atmosphäre. Über die Hintergründe dieses Vorgangs wird bis heute
spekuliert.
Noch immer gibt es Tiere und Pflanzen nur im Wasser. Erst am 30. November unseres
Modelljahres gehen die ersten Pflanzen an Land. Aus dieser Zeit, um den 1. Dezember, haben
wir einige Kenntnisse über die Verteilung von Land und Meer, die damals ganz anders als
heute aussah. Ein gewaltiger Südkontinent, den die Geologen Gondwanaland nennen, lag am
Südpol der Erde. Er umfasste Südamerika, Afrika, Indien, Antarktis und Australien. Das
heutige Wüstengebiet der Sahara lag am Südpol der Erde und war von einem mächtigen
Eispanzer bedeckt, wie heute die Antarktis.
Nordamerika war gegenüber der heutigen Lage ungefähr um 45° im Uhrzeigersinn gedreht,
und der Äquator verlief von Mexiko zur Hudsonbay in Kanada. Zwischen Afrika und
Nordamerika lag ein Ur-Atlantik von 8000 km Breite, der - vor allem durch ein Driften
Afrikas vom Südpol nach Norden - allmählich schmaler wird und sich am 13. Dezember
schließt.
Aber noch sind wir nicht so weit.
6. Dezember
Am 6. Dezember kriechen die ersten Tiere auf das Festland. Ein wichtiger Schritt in der
Entwicklung des Lebens ist damit getan. Wir können uns heute vorstellen, warum es bis zu
diesem Schritt so lange gedauert hat - die Schwerkraft, im Wasser kaum spürbar, ist
ungewohnt, und die Trockenheit muss durch einen Trick, nämlich durch die Entwicklung
eines inneren Flüssigkeitskreislaufs zur Versorgung der Körperzellen, überwunden werden.
Auch die Temperaturunterschiede sind auf dem Lande viel größer als im Wasser. Ähnlich
große Schwierigkeiten hatten erst die menschlichen Astronauten zu überwinden, als sie zum
ersten Mal die Erdatmosphäre verließen und sich gegen Vakuum, Schwerelosigkeit und
kosmische Strahlung schützen mussten.
7. Dezember
Am 7. Dezember beginnt das Karbon-Zeitalter. Die Wälder, deren Überreste wir heute als
Steinkohle verheizen, wachsen und vergehen; in ihnen tummeln sich Reptilien und Insekten.
12. Dezember
Irgendwann in dieser Zeit, zwischen dem 7. und 12. Dezember unseres Modelljahres,
entwickeln sich aus den Reptilien die ersten Säugetiere, die ersten Vögel und die
Riesenechsen, die Saurier.
Ungefähr am 12. Dezember, am Ende des Karbonzeitalters, beginnt eine neue große Eiszeit,
die bis zum 14. Dezember anhält. Von ihr ist vor allem der große Südkontinent betroffen, der
aus den damals zusammenhängenden Kontinenten Südamerika, Afrika, Indien, Antarktis und
Australien besteht.
13. Dezember
Am 13. Dezember, beim Zusammenstoß des Nord- und Südkontinents, falten sich in
Nordamerika die Appalachen, in Nordafrika das Atlasgebirge und in Deutschland die meisten
Mittelgebirge (variskische Faltung). Der Ur-Atlantik ist verschwunden, alle Kontinente bilden
nun einen einzigen großen Festlandsblock. Saurier, Säugetiere, Vögel und Insekten, breiten
sich ungehindert aus und entwickeln zahlreiche neue Arten und Formen.
16. Dezember
Bis zum 16. Dezember bleibt der Urkontinent zusammen. Dann reißt er auseinander,
getrieben von den Kräften des Erdinnern. Die Gezeitenwirkung des Mondes kann kaum eine
große Rolle gespielt haben; der Mond hatte schon fast den gleichen Abstand wie heute.
Zwischen dem 16. und 19. Dezember zerbricht der Urkontinent in vier große Platten:
"Laurasia", bestehend aus Nordamerika, Europa und Asien; Südamerika mit Afrika; Indien;
Antarktis mit Australien.
27. Dezember
Im gleichen Zeitraum gelingt es den Sauriern, die beherrschende Lebensform auf der ganzen
Erde zu werden. Die Zahl der Gattungen größerer Säugetiere sinkt von 175 am 16.12. auf
Null am 19.12.; alle Säugetiere mit mehr als 2 kg Körpergewicht verschwinden, vermutlich
ausgerottet von den größeren, stärkeren und besser gepanzerten Sauriern. Die Alleinherrschaft
der Saurier dauert vom 19. bis zum 27. Dezember - ungefähr 9 Tage unseres Modelljahres
oder 130 Millionen Jahre. Dann, am Mittag des 27. Dezember, sterben sie "plötzlich und
unerwartet" aus. Die Ursache ihres Aussterbens ist nicht mit Sicherheit bekannt. Es gibt
deutliche Hinweise auf einen größeren Meteoriteneinschlag genau zu jener Zeit. Dabei
wurden gewaltige Mengen Erde und Gestein verdampft und verdunkelten für mehrere Jahre
die Atmosphäre. Die damit verbundenen Veränderungen des Erdklimas könnten den Sauriern
die Lebensgrundlage entzogen haben. Kleinere Säugetiere, die Vögel, die Insekten und einige
Reptilien hatten bessere Überlebenschancen. Es gibt jedoch auch Indizien für andere
Ursachen des Massensterbens. Übrigens sind auch die Ammoniten, deren Versteinerungen
wir in großer Zahl in der Schwäbischen Alb finden, zusammen mit den Sauriern am Mittag
des 27. Dezember ausgestorben.
Nach dem Ende der Saurier, am Nachmittag des 27. Dezember, beginnt der Aufstieg der
Säugetiere.
Inzwischen, d. h. in der Woche nach dem 19. Dezember, hat sich Südamerika von Afrika
gelöst und beginnt nach Westen zu treiben, während im Norden Nordamerika von Grönland
abreißt. Grönland ist noch bis zum 27. Dezember mit Norwegen verbunden.
28. Dezember
Am 28. und 29. Dezember entstehen bei Zusammenstößen kontinentaler Schollen und
Ozeanböden alle heutigen Hochgebirge - die Rocky Mountains in Nordamerika, die
Landverbindung zwischen Nord- und Südamerika, die Anden in Südamerika, die Alpen, die
Karpaten, der Kaukasus in Europa. In Asien rammt Indien am 29. Dezember gegen Tibet, und
der Zusammenstoß führt zur Auffaltung des Himalaya-Gebirges. Nun erst, drei Tage vor
Jahresende, hat die Erdoberfläche im wesentlichen die uns vertraute Gestalt; Einzelheiten, z.
B. der 2000 km lange Golf von Kalifornien entstehen erst am Nachmittag des 31. Dezember.
31. Dezember
Aber noch immer gibt es keine Spur von einem Menschen. Erst am Abend des 31. Dezember
(etwa zu Beginn der Tagesschau im Fernsehen) finden sich erste Spuren früher
Menschentypen in Ostafrika. Gegen 22 Uhr beginnt in Europa, Asien und Nordamerika eine
Periode großer Vereisung mit wärmeren Zwischenzeiten. Um 23 Uhr 50, in einer solchen
Zwischen-Warmzeit, ist die Höhle im Neandertal bei Düsseldorf bewohnt. Um 23 Uhr 57
beginnt der vorläufig letzte große Vorstoß des Eises, in Deutschland werden Teile Schleswig-
Holsteins, Pommern und Ostpreußen unter Gletschern begraben. Um 23 Uhr 58 entstehen die
Höhlenmalereien in Lascaux und in Altamira. Um 23 Uhr 59 tauen die Gletscher in der
norddeutschen Tiefebene und in Skandinavien.
Erst in diesem Augenblick, mit der letzten Minute unseres Modelljahres, beginnt die
eigentliche Kulturgeschichte der Menschheit.
Um 23 Uhr 59 und 28 Sekunden wird in Ägypten die Cheopspyramide errichtet. 18 Sekunden
vor Mitternacht werden die Bücher Moses, Homers Ilias und Odyssee geschrieben. 13
Sekunden vor Mitternacht wird Christus geboren und gekreuzigt. 4 Sekunden vor Mitternacht
wird die Buchdruckerkunst erfunden, 3 Sekunden vor Mitternacht sucht Kolumbus den
Seeweg nach Indien und stößt auf Amerika. In der vorletzten Sekunde vor Mitternacht leben
Napoleon, Goethe und Beethoven.
In der letzten Sekunde des Jahres versechsfacht sich die Erdbevölkerung, verbraucht einen
großen Teil ihrer Kohle-, Öl- und Erzvorräte und bringt sich in Gefahr, ihre Umwelt zu
vergiften und die Erde unbewohnbar zu machen.
(Ende des Vortragstextes)
Und weiter?
Wie groß sind die Chancen für die Menschheit, eine weitere Minute zu überleben, also bis
zum Jahr 12000 n. Chr.? Oder bis 0 Uhr und 10 Minuten? Oder gar bis 1 Uhr der
Sylvesternacht? Ganz zu Schweigen vom 2. Januar des neuen Jahres oder gar dem 1. Februar?
Die Sonne hat noch für viele Monate Brennstoff. Im Februar wird die Leuchtkraft der Sonne
spürbar zunehmen, und die Temperaturen auf ungemütliche Werte ansteigen. Aber
wahrscheinlich wird das niemanden mehr tangieren.
Tipp
Wie wärs, nächstes Jahr diese Geschichte gedanklich einmal durchzuspielen? Vielleicht
einfach die wichtigsten Stationen in den Kalender oder in ein Kalenderprogramm eintragen
und zu Sylvester ein paar Gedenksekunden einlegen ...